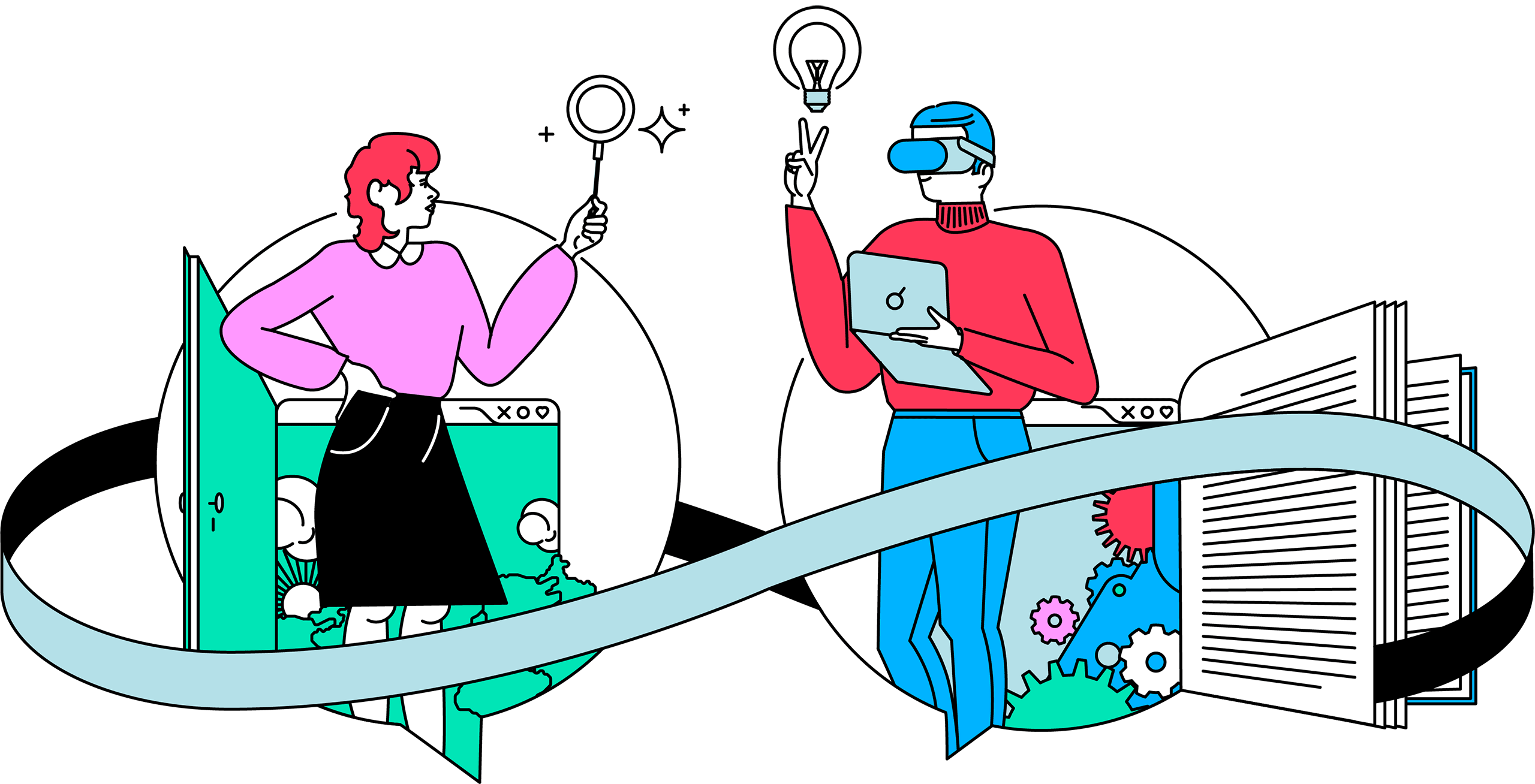
Der Kompetenzverbund lernen:digital gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung.
Über den Kompetenzverbund
Vier Kompetenzzentren bündeln die Expertise aus rund 200 länderübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten. In den Projekten entstehen evidenzbasierte Fort- und Weiterbildungen, Materialien sowie Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer Kultur der Digitalität.
Über die Kompetenzzentren
Eine Transferstelle macht die Ergebnisse für Lehrkräfte sichtbar, fördert die konstruktive Weiterentwicklung mit der Praxis und unterstützt den bundesweiten Transfer in die Lehrkräftebildung.
Über die Transferstelle
Drittklässlerin Marie hat ein Problem in Mathematik. In Aufgaben zu Addition und Subtraktion kommt sie nicht zu den richtigen Lösungen. Woran liegt es? Gibt es Muster in ihren Fehlern? Die Diagnosekompetenz der Lehrkraft ist jetzt gefragt. Und genau diese Kompetenz wird im Projekt D1MA2 an der Technischen Universität (TU) München, eingebunden in den Projektverbund DigiProMIN, mithilfe von Simulationen in Lehrkräftefortbildungen gestärkt.
Hat Marie vielleicht ein Problem mit dem Stellenwertverständnis? Fällt ihr also die Einteilung in Hunderter, Zehner und Einer schwer? Aus einem Aufgabenpool können Lehrer:innen in einem Online-Tool eine Aufgabe auswählen, die diese Schwierigkeit adressiert. Das Tool zeigt an, zu welchem Ergebnis die fiktive Schülerin gekommen wäre. „Und tatsächlich, die Schülerin macht hier einen Fehler“, schildert Michael Nickl, Mathematikdidaktik-Forscher an der TU München. Nun kann die Lehrkraft eine Hypothese formulieren, worin das Problem besteht und in der Simulation weitere Aufgaben für Marie auswählen.

Ihre Beobachtungen, Hypothesen und Schlussfolgerungen schreibt die Lehrkraft in dem Online-System auf – und bespricht ihre Diagnosen im Rahmen der Fortbildung. Hat sie zum Beispiel die passenden Aufgaben ausgewählt, um das Problem der Schülerin zu bearbeiten?
„Erkenntnisse lassen sich gut in die Praxis umsetzen“
Drei Präsenz-Fortbildungen gab es zu dem Thema – zwei in Studienseminaren in Bayern, eine am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) in Schleswig-Holstein. Und das Feedback der Teilnehmenden fiel positiv aus, berichtet Nickl. Eine Rückmeldung lautete: „Ich habe gelernt, wie Fehler einzuordnen sind und was dafür ursächlich sein kann.“ Eine andere: „Die Beispiele und Erkenntnisse lassen sich gut in die Praxis umsetzen.“
DigiProMIN, ein Verbund von insgesamt neun wissenschaftlichen Einrichtungen, steht beispielhaft für die Impulse, die das Kompetenzzentrum MINT in den vergangenen mehr als zwei Jahren in der Lehrkräftefortbildung gesetzt hat. Am 30. September 2025 endete die Förderphase der Projektverbünde im Kompetenzzentrum nach zweieinhalb Jahren Laufzeit.
Es ist eines von vier Kompetenzzentren sowie einer Transferstelle, die den Kompetenzverbund lernen:digital bilden. Er wird finanziert durch die Europäische Union – NextGenerationEU und vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) gefördert. Der Kompetenzverbund soll den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die Lehrkräftebildung und die digitale Transformation von Schule stärken. Zudem schafft er evidenzbasierte Angebote für die Professionalisierung von Lehrkräften und für die Schulentwicklung im Blick auf die Digitalisierung. Formate, die langfristig etabliert werden sollen.

„Es ist eine sehr, sehr große Bandbreite an Professionalisierungsangeboten entstanden“, berichtet Katharina Scheiter, Professorin für Digitale Bildung an der Universität Potsdam und wissenschaftliche Leitung von DigiProMIN sowie der Transferstelle vom Kompetenzverbund. Allein im MINT-Bereich seien es nahezu 100 Fortbildungsreihen und mehr als 200 Einzelmodule für die Weiterqualifizierung von Lehrkräften. Bereits beim virtuellen Messeformat Fachforum MINT im Juni hatte das Kompetenzzentrum einen umfassenden Einblick in die Angebote gegeben, wovon viele in den Broschüren des Kompetenzverbunds verzeichnet sind.
Kompetenzzentrum hat Fachlichkeit in Fortbildungen betont
Verantwortlich dafür waren insgesamt sechs Projektverbünde, in denen bundesweit 36 wissenschaftliche Einrichtungen zusammengearbeitet haben. Nach Ansicht Scheiters haben sie es geschafft, die fachdidaktische Ausrichtung von Fortbildungen zu betonen. Ein Punkt, den Daniel Pittich von der TU München, Sprecher des Kompetenzzentrum MINT, unterstreicht. „Ich denke, wenn es um eine Veränderung des Unterrichts geht, muss man zwingend noch stärker die Fachdidaktik und damit auch eine Fachlichkeit fokussieren.“
Besonders im MINT-Bereich birgt der digital gestützte Unterricht großes Potenzial. Stefanie Schwedler, Professorin für die Didaktik der Chemie an der Universität Bielefeld, veranschaulicht das mit einem Einblick in eine Fortbildung für Chemielehrkräfte. Das Problem sei, dass man Prozesse, die sich auf der kleinsten Teilchenebene abspielen, nicht sehen könne. Zugleich sind sie kompliziert. „Simulationen sind daher gerade im Bereich der Molekulardynamik sehr hilfreich.“

Die Vorgänge würden für die Schüler:innen nicht nur visualisiert. „Sie können tatsächlich auch etwas ausprobieren.“ Schwedler zeigt das auf einem Bildschirm anhand einer anschaulichen Teilchensimulation eines Gasgemisches. Es besteht aus dem farblosen Distickstofftetroxid und dem braunen Stickstoffdioxid. „Die Schüler:innen sehen erst mal, dass die Teilchen in ständiger Bewegung sind.“ Und: Die Jugendlichen können nun die Regler für die Temperatur oder den Druck verschieben und genau beobachten, wie sich die Teilchen neu anordnen und sich die Farbe des Gemisches verändert.
Simulationen aktivieren innere Vorstellungsbilder
„Das kann sehr lernwirksam sein, wenn die inneren Vorstellungsbilder der Schüler:innen aktiviert werden“, sagt Schwedler. Zugleich betont sie, dass Simulationen allein dazu nicht ausreichen. Es brauche einen klaren Arbeitsauftrag und eine strukturierte Begleitung der Schüler:innen durch die Lehrkraft. Sonst sei die Simulation Zeitverschwendung. Die entsprechende Fortbildung, eines der Angebote im Projektverbund LFB-Labs-digital, umfasst drei Präsenztermine. Sie findet in Zusammenarbeit mit den teutolabs statt, einem Schüler:innenlabor an der Universität Bielefeld.
Auch in den Angeboten, die im Kompetenzzentrum MINT zur beruflichen Bildung entstanden sind, hat die Simulation ihren festen Platz. Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen etwa bietet im Projektverbund D4MINT „Simulationen beruflicher Handlungen am Beispiel des Schweißens“ an. Schüler:innen haben hier einen Schweißhelm mit integriertem AR-Display auf dem Kopf, tragen geeignete Handschuhe und haben einen Brenner in der Hand. Dann schweißen sie im virtuellen Raum.
„Wir zeigen hier nicht nur ein Video, sondern simulieren wirklich einen Teil der beruflichen Handlung“, sagt die Projektverantwortliche Anne Pursche. So lässt sich aus Fehlern lernen, etwa wenn die Haltung des Brenners falsch oder die Geschwindigkeit beim Schweißen zu hoch ist. Dass die Lehrkräfte das Gerät in den Fortbildungen selbst ausprobieren, ist in Pursches Augen wichtig. „Man muss so eine Simulation als Lehrkraft getestet haben, um entscheiden zu können, mit welchen didaktischen Zielen und wie man sie am besten im Unterricht einbindet.“

Jonny Kraft, Fachleiter für Metalltechnik am Staatlichen Studienseminar für Lehrerbildung in Thüringen, ist überzeugt: „An den Berufsschulen steht die berufliche Handlung immer im Zentrum. Wenn die Auszubildenden beispielsweise Schweißprozesse planen und im Laborunterricht umsetzen sollen, benötigt die Schule umfangreiche technische Voraussetzungen.“ Das könnten sich nur wenige Schulen leisten.
Professionalisierungsformate auch für den adaptiven, digital gestützten Unterricht
Die Beispiele stehen für die Potenziale, um Digitales – speziell die Möglichkeiten zur Diagnose, Veranschaulichung und Nachahmung – mit der Fachdidaktik zu verbinden. Zu den im Kompetenzzentrum MINT entwickelten Angeboten gehören aber auch fachübergreifende Professionalisierungsangebote für Lehrkräfte. Zu ihnen zählt ein Online-Selbstlernkurs zum adaptiven, digital gestützten Unterricht.
Entstanden ist er im Projektverbund MINT-ProNeD. Er soll Lehrkräfte darin unterstützen, den verschiedenen Lernvoraussetzungen der zunehmend heterogenen Schüler:innen zu begegnen. Dazu gibt es vier Module. Sie umfassen etwa eine Selbsteinschätzung zur bisherigen Umsetzung adaptiven Unterrichts und vertiefende, an die Selbsteinschätzung angepasste Videos und Texte zur Theorie. Auch Unterrichtsvideos und sogenannte Retrieval-Practice-Elemente zum aktiven Abrufen von Informationen wie Quizze sind Teil des Kurses, um das erworbene Wissen zu verankern.Angesichts der zunehmend heterogenen Schüler:innenschaft ist Adaptivität ein Schlüssel für gelingenden Unterricht. Viele Angebote des Kompetenzzentrum MINT adressieren das, so auch der Online-Kurs „Digital und Binnendifferenziert – Das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht“. Entstanden ist er im Projektverbund ComᵉMINT.
Software-Kompetenzen für den adaptiven Unterricht
Der Kurs vermittelt in frei wählbaren Modulen grundlegendes und vertiefendes Wissen zu Heterogenität und Binnendifferenzierung – etwa mit Videos, Gesprächen mit Expert:innen und weiterführenden Literaturverweisen. Zugleich schult das Format die Teilnehmenden darin, digital Lernhilfen zu erstellen, die an die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler:innen angepasst sind. Die kostenlose und quelloffene Software H5P ermöglicht es zum Beispiel, kleine Lerneinheiten wie Lückentexte oder Drag-and-Drop-Aufgaben zu erstellen. Die Schüler:innen können sie selbständig bearbeiten und erhalten eine direkte, automatisierte Rückmeldung.
In der Fortbildung „Dem Sehsinn auf der Spur – Einsatz von digitalen Technologien beim Experimentieren und Differenzieren“ des Projektverbunds MINT-ProNeD wiederum steht ein Experiment zum Farbensehen in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit im Zentrum. In einem Teilmodul dieses Formats der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau geht es darum, wie Lehrkräfte mithilfe von PowerPoint adaptive digitale Begleitmaterialien für ihre Schüler:innen erstellen und nutzen können. Ziel ist es, dass die Schüler:innen ihren Lernprozess individuell selbst steuern.
Idee des „didaktischen Doppeldeckers“ prägt Angebote
Viele Kursangebote zeichnet aus, dass sie auch selbst adaptiv sind. Denn zum einen orientieren sich Inhalte an der Selbsteinschätzung der Lehrkräfte, zum anderen können die Lehrkräfte entscheiden, welche Inhalte sie vertiefen wollen und wann sie sich diesen Inhalten widmen. Das Prinzip des „didaktischen Doppeldeckers“, dass also Lern- und Lehrprozess gleichzeitig stattfinden, kommt damit zum Einsatz – genau wie bei der Fortbildung zum Schweißen, in der sich Lehrkräfte selbst im virtuellen Raum probieren mussten.

Wie geht es nun weiter mit den entwickelten Angeboten? Wichtig ist das Zusammenspiel mit den Landesinstituten und der Schulpraxis, um die Fortbildungen einem möglichst großen Kreis von Lehrkräften bekannt und zugänglich zu machen. Dabei spielt die Plattform ComPleTT eine wichtige Rolle. Katharina Scheiter ist optimistisch: „Wir haben Strukturen geschaffen, die auch längerfristig wirken können.“ Und die Bandbreite dessen, was man in den MINT-Fächern machen könne, sei noch lange nicht ausgeschöpft. Noch Mitte des Jahres hatte das Nationale MINT Forum bei der Vorstellung vom MINT-Frühjahrsreport 2025 unter anderem gefordert, die Qualität des Unterrichts zu sichern. „Um eine zeitgemäße und praxisnahe MINT-Bildung zu gewährleisten, müssen mehr gut ausgebildete Lehrkräfte gewonnen und gehalten werden“, hieß es. Die Arbeit des Kompetenzzentrum MINT bietet dafür zahlreiche Anknüpfungspunkte.
Text: Holger Schleper
Fotos: Phil Dera und Nadine Zilliges
Informationen zur länderübergreifenden Plattform ComPleTT
Mit der „Common Plattform for electronic Teacher Training“ (ComPleTT) unterstützen die Bundesländer den Transfer der Ergebnisse vom Kompetenzverbund lernen:digital in das bestehende System der Lehrkräftebildung. Im Kompetenzverbund haben die beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen zahlreiche Fortbildungen entwickelt, ausgestaltet, erprobt und evaluiert. Diese Angebote sollen weiter systematisch mit den Landesinstituten verzahnt werden.
Betreut wird ComPleTT von der „AG Digitale Formate in der Lehrkräftefortbildung“ unter der Federführung von Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Länder finanzieren die Plattform über die Kultusministerkonferenz (KMK), angesiedelt ist sie beim Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF). Bei der lernen:digital Tagung „Digitale Transformation für Schule und Lehrkräftebildung gestalten“ an der Universität Potsdam Ende September 2025 zählte das Potenzial der Plattform ComPleTT zu den viel diskutierten Themen.
lernen:digital Projektverbünde im Kompetenzzentrum MINT
ComᵉMINT: Der Verbund hat das Ziel, prototypische, digitalisierungsbezogene Professionalisierungskonzepte für MINT-Lehrkräfte und Multiplikator:innen zu entwickeln. Dabei liegt der Fokus auf den Fächern Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Physik & Technik und Sachunterricht.
D4MINT: Die Entwicklung und nachhaltige Verankerung von Fortbildungen, um MINT-Lehrkräfte im Bereich digitaler Technologien zu professionalisieren, stehen im Zentrum des Verbunds. D4MINT kombiniert innovative Inhalte wie Data Literacy mit innovativen Formaten wie digitalen Experimentierwerkzeugen.
DigiProMIN: Der Verbund unterstützt Lehrkräfte der Fächer Mathematik, Informatik sowie der Naturwissenschaften, digitalisierungsbezogenen Kompetenzen für die Gestaltung guten Unterrichts mit digitalen Medien weiterzuentwickeln. Hierzu entwickelt er Professionalisierungsbausteine in der Fort- und Weiterbildung.
LFB-Labs-digital: Ziel des Verbunds ist es, Schüler:innenlabore als Lernorte für die digitale Lehrkräftefort- und -weiterbildung zu erschließen. Forschungsbasiert identifiziert der Verbund, was die Voraussetzungen sind, um diesen Ansatz in die Tat umzusetzen.
LPI: Als „Länder- und phasenübergreifendes Interface der beruflich-technischen Bildung” stellt der Verbund die Digitalisierung des beruflich-technischen Lehrens und Lernens – in fachlicher, methodischer und medialer Hinsicht – ins Zentrum seiner Arbeit.
MINT-ProNeD: Ziel des Verbunds ist es, ein integratives Gesamtkonzept für die MINT-Lehrkräftebildung zu etablieren. Lehrkräfte können in diesen Netzwerken ihre Kompetenzen im Blick auf einen adaptiven, digital gestützten MINT-Unterricht weiterentwickeln.





















