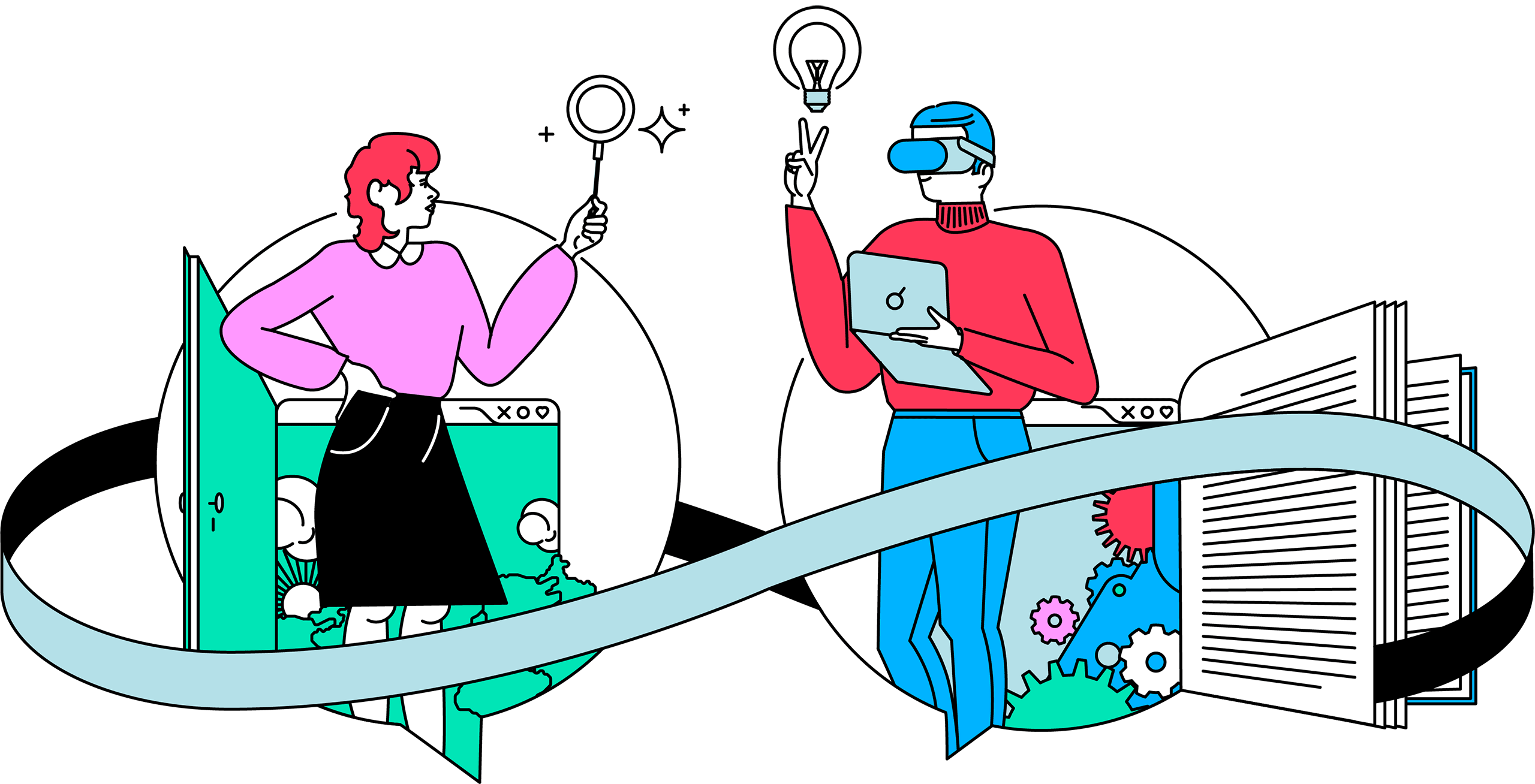
Der Kompetenzverbund lernen:digital gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung.
Über den Kompetenzverbund
Vier Kompetenzzentren bündeln die Expertise aus rund 200 länderübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten. In den Projekten entstehen evidenzbasierte Fort- und Weiterbildungen, Materialien sowie Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer Kultur der Digitalität.
Über die Kompetenzzentren
Eine Transferstelle macht die Ergebnisse für Lehrkräfte sichtbar, fördert die konstruktive Weiterentwicklung mit der Praxis und unterstützt den bundesweiten Transfer in die Lehrkräftebildung.
Über die Transferstelle
Interview mit Jens Klusmeyer. Redaktion: Petra Schraml, DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Die Arbeit im Kompetenzzentrum Sprachen/Gesellschaft/Wirtschaft ist weit fortgeschritten. Welche Ziele haben Sie sich zu Beginn für den Projektverbund „Wirtschaftspädagogik und Ökonomische Bildung: Lehrkräftebildung und Unterricht digital“ (WÖRLD) gesetzt? Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bisher erreicht haben?
Im Projektverbund WÖRLD haben wir zwei Zielperspektiven aufgenommen. Zuvorderst stand, dass alle Kolleg:innen unserer 14 Teilprojekte ihre Expertise einbringen, um digitale Lernumgebungen, Unterrichtsszenarien oder digital gestützte Lehr-Lernprozesse für die ökonomische und wirtschaftsberufliche Lehrpersonenbildung zu entwickeln, zu pilotieren und zu evaluieren. Hierzu haben sie bestehende Strukturen und Netzwerke zu Ministerien, Landes- und Fortbildungsinstituten und (Berufs-)Schulen genutzt und neu aufgebaut.
Die zweite Zielperspektive betrifft unser WÖRLD Konsortium selbst. Die Teilprojektakteur:innen wirken zusammen mit der Verbundleitung an der Konzeption eines WÖRLD-House betitelten Transfer-House-Konzeptes mit – wir kommen ja vielleicht noch darauf zu sprechen.
Ihre Frage nach der Zufriedenheit mit dem bisher Erreichten kann ich für beide Zielbereiche nur mit einem deutlichen „Ja“ beantworten. In den Teilprojekten sind zeitgemäße und lernförderliche Fortbildungsangebote entstanden und unser WÖRLD-Transfer-House hat entsprechende Unterstützungsstrukturen aufgebaut. Mein „Ja“ darf jedoch nicht als ein abschließendes „Ja, wir haben alles erreicht“ fehlverstanden werden. Wir haben noch Arbeit in den Teilprojekten und im Projektverbund vor uns und noch deutlich mehr, wenn es um das Gesamtthema der digitalen Transformation von (beruflicher) Schule und (beruflicher) Lehrpersonenfortbildung im Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis geht.

„In den Teilprojekten sind zeitgemäße und lernförderliche Fortbildungsangebote entstanden und unser WÖRLD-Transfer-House hat entsprechende Unterstützungsstrukturen aufgebaut.“
Welche Fortbildungen haben Sie entwickelt?
Das zu beschreiben ist angesichts von 14 Fortbildungsthemen und -formaten eine Aufgabe, wofür hier die Zeit und der Platz nicht ausreichen werden. Ich kann daher an dieser Stelle nur ein paar Beispiel nennen:
Auf der Ebene der Nutzung digitaler Lernumgebungen wird im Projekt „Begründete Entscheidungen treffen – Simulationsbasiertes Lernen in LUCA Office“ eine Bürosimulation angeboten, in der kaufmännische Arbeitsszenarios realitätsnah durchlaufen werden können.
Fortbildungen zu digital gestützten Lehr-Lernprozessen finden Sie in den Projekten „Wirtschaft unterrichten mit digitalen Experimenten“, die zur Förderung der Urteils- und Entscheidungskompetenzentwicklung eingesetzt werden, oder im Projekt „Erklärvideos beurteilen anhand des Themas Subventionen“, in dem medial die Lebensrealität der Schüler:innen aufgegriffen und mit ökonomischen Themen verbunden wird.
Im Projekt „Branching Scenarios im wirtschaftsberuflichen Unterricht zum Thema Zahlungsverzug und Kulanzentscheidungen“ werden digitale Unterrichtsszenarien mit H5P erstellt. Die Lehrenden erarbeiten eine authentische Lernsituation, die interaktiv abgebildet ist, durch welche die Lernenden selbst navigieren können und innerhalb derer sie an verschiedenen Punkten interaktive Aufgaben bewältigen und realitätsnahe Entscheidungen treffen müssen.
Natürlich spielt auch der KI-Einsatz in der beruflichen Bildung und in WÖRLD eine bedeutende Rolle: Im Projekt KIWI-MOOC wird ein Online-Selbstlernkurs zur Förderung der KI-Kompetenzen von (angehenden) Lehrkräften angeboten. Er umfasst sieben Module zu verschiedenen Themen rund um das Thema „KI im Lehrberuf“.
Für interessierte Personen liegt die informative Broschüre „Wirtschaft“ des Kompetenzverbund lernen:digital vor, in der die jeweiligen Fortbildungsthemen vorgestellt und darüber hinaus unterrichtliche Phasenkonzepte und Materialien eingesehen werden können. Hinzu kommt noch unsere sehr gut angenommene eigene Broschüre, die wir bereits zu Projektbeginn erstellen und verteilen konnten.
Wo liegt der besondere Anspruch Ihrer Fortbildungen?
Bei der Lektüre der Broschüren wird ersichtlich, dass wir die digitale Transformation in der Arbeits- und Lebenswelt der Menschen als Ausgangspunkt unserer fachdidaktischen Bearbeitung nehmen. Die Herausforderung besteht also beispielsweise darin, digitale Transformationsprozesse in den Unternehmen und Betrieben zu erfassen, diese in einem Fortbildungsprogramm für Lehrpersonen fachdidaktisch zu remodulieren, sodass die teilnehmenden Lehrpersonen befähigt werden, einen digitalisierungsbezogenen Unterricht anbieten zu können. Dieser wiederum versetzt die Schüler:innen in die Lage, in der digitalisierten Arbeits- und Lebenswelt angemessen, verantwortungsvoll und kritisch-mitgestaltend zu handeln. Es geht also um die fachliche Kompetenzentwicklung bei den Lehrenden und Lernenden über die Entwicklung und den Einsatz digitaler Lernumgebungen und digital gestützter Lehr-Lernarrangements.

„Die Herausforderung besteht also beispielsweise darin, digitale Transformationsprozesse in den Unternehmen und Betrieben zu erfassen, diese in einem Fortbildungsprogramm für Lehrpersonen fachdidaktisch zu remodulieren, sodass die teilnehmenden Lehrpersonen befähigt werden, einen digitalisierungsbezogenen Unterricht anbieten zu können.“
Die fachlichen und digitalisierungsbezogenen Expertisen der beteiligten Partner werden im sogenannten WÖRLD-House gebündelt. Was ist darunter zu verstehen?
Das WÖRLD-House wird im Projektverbund im Sinne eines Transfer-House Konzepts konzeptualisiert. Die Vertreter:innen aus der Ökonomischen Bildung (Deutsche Gesellschaft für Ökonomische Bildung – DeGÖB, Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft – GSÖBW) und Wirtschaftspädagogik (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft – DGfE –Sektion 7: Berufs- und Wirtschaftspädagogik – BWP) treten zusammen mit der WÖRLD-Projektleitung als neues Akteursnetzwerk auf und erarbeiten in stetigem Austausch unter anderem Design-, Implementations- und Evaluationskonzepte für die digitalen und hybriden Produkte. Das WÖRLD-House stellt sich als steuernde, koordinierende und unterstützende Instanz im Projektverbund dar. Der Aufbau folgt einer dreigliedrigen Struktur, die unterschiedliche Steuerungs-, Koordinations- und Evaluationsbedarfe adressiert: Die Verbundleitung übernimmt die strategische Steuerung des Netzwerks, insbesondere durch das Setzen gemeinsamer Ziele und Erwartungshaltungen. Sie sorgt dafür, dass ein kohärenter Zielrahmen als Orientierungsfolie für alle Beteiligten entsteht. Das Projektmanagement koordiniert die operativen Aktivitäten des Netzwerks, plant gemeinsame Treffen, identifiziert relevante Informationen und Distributionswege und ist verantwortlich für den Aufbau und die Pflege der internen Kommunikation zwischen den Netzwerkmitgliedern untereinander und zur lernen:digital Transferstelle. Zusätzlich ist das Projektmanagement auch für die Wissenschaftskommunikation und die öffentliche Sichtbarkeit der Netzwerkaktivitäten zuständig – also für die zielgruppenorientierte Vermittlung von Projektergebnissen und ‑fortschritten nach außen.
Die Projektevaluation begleitet die Prozesse analytisch und überprüft sowohl die Wirksamkeit der Aktivitäten des Transfer-Houses als auch die Transferaktivitäten der Netzwerkmitglieder. Dies schafft eine kontinuierliche Reflexionsgrundlage für die Weiterentwicklung des Netzwerks. Ich möchte Ihnen gern ein Beispiel für die Unterstützungsleistungen des WÖRLD-Houses für unsere Teilprojekte geben. Einblick in die Fortbildungskonzepte und die Begleitforschung der Teilprojekte gewährte das Konsortium über die digitale Ringvorlesung „Around the WÖRLD“, die im Wintersemester 2024/2025 und im Sommersemester 2025 durchgeführt wurde. Die Teilnehmenden aus den Zielgruppen der Lehrpersonen, Studierenden, Vertreter:innen der ersten bis dritten Phase der Lehrer:innenbildung und Fachverbände konnten im Sinne ko-kreativer Prozesse Impulse für die Ausgestaltung der 14 digitalen und/oder hybriden Fortbildungskonzepte setzen.
Insgesamt hat die Arbeit des WÖRLD-Houses die Aktivitäten und den Erfolg des Projektverbundes maßgeblich befördert. Im Zuge der Evaluation wird uns immer wieder gespiegelt, dass die Strukturen des WÖRLD-Houses funktionieren und allen Beteiligten ermöglichen, sich einzubringen. Besonders hervorzuheben ist dabei die hervorragende Arbeit der WÖRLD-House Mitarbeiter:innen Herrn Thiel de Gafenco, Frau Sina Schadow und Frau Melanie Keßeler. Aus den kontinuierlich erhobenen Evaluationsdaten leiten wir vertiefte Kenntnisse zur Modellierung und Leistungsfähigkeit von Transfer-Houses im Kontext von Verbundstrukturen auf drei Ebenen ab, nämlich für die a) interne Verbundkoordination, b) Dissemination der Ergebnisse in Forschung und Praxis und c) Strukturen in Förderprogrammen zur Lehrpersonenbildung.

„Im Zuge der Evaluation wird uns immer wieder gespiegelt, dass die Strukturen des WÖRLD-Houses funktionieren und allen Beteiligten ermöglichen, sich einzubringen.“
An dem Projektverbund WÖRLD sind 14 Universitäten in verschiedenen Bundesländern beteiligt. Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert und vor welchen Hürden stand sie zunächst?
Auf den ersten Blick stellt sich WÖRLD als ein sehr homogener Projektverbund dar, zumal er auf eine Domäne „Wirtschaft“ fokussiert. Jedoch, und das ist eine herauszuhebende Besonderheit, arbeiten erstmals Kolleg:innen aus den Fachgesellschaften „Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik“ (BWP) der „Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften“ (DGfE), der „Deutschen Gesellschaft für ökonomische Bildung“ (DeGÖB) und der „Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft“ (GS*ÖBW) zusammen in einem Projektverbund zur Lehrpersonenbildung. Dieses Konsortium ermöglicht Fortbildungsangebote für die gesamte Bandbreite der Lehrpersonenbildung von der ökonomischen Bildung in der Sekundarstufe I und II bis zur wirtschaftsberuflichen Bildung in den beruflichen Vollzeit- und Teilzeitschulen.
Diese Zusammenarbeit hat auf persönlicher und inhaltlicher Ebene hervorragend funktioniert. Mit der Projektleitung konstituierte sich ein Akteursnetzwerk, das aufgrund einer „domänenbezogenen Wissenschaftssprache“ schnell und äußerst zielgerichtet die Arbeit aufnehmen konnte. Es besteht ein gegenseitiges Verständnis – wir verstehen uns! Dies zeigt sich an der stets sehr guten Beteiligung an unseren zweimal im Jahr stattfindenden Verbundtreffen an der Universität Kassel sowie an den monatlich ausgerichteten Jour-fixe-Terminen zur Organisation der operativen Arbeit. Dass die bisher weitgehend getrennt operierenden Scientific Communities zueinander finden, wird durch den gegenseitigen Besuch der Fachtagungen deutlich. Bereits im September 2023 und im Februar 2024 präsentierten die Kolleg:innen der jeweils anderen Fachgesellschaft ihre Projekte auf der BWP-/DGfE- und DEGÖB-Tagung. Auch aus den Teilprojekten wird das WÖRLD-House dafür gelobt, erfolgreich eine Brücke zwischen der Wirtschaftspädagogik und der Ökonomischen Bildung zu schlagen.

„Dieses Konsortium ermöglicht Fortbildungsangebote für die gesamte Bandbreite der Lehrpersonenbildung von der ökonomischen Bildung in der Sekundarstufe I und II bis zur wirtschaftsberuflichen Bildung in den beruflichen Vollzeit- und Teilzeitschulen.“
Haben Sie auch mit anderen Projektverbünden, vielleicht auch aus anderen Kompetenzzentren zusammengearbeitet?
Ja, die Vernetzung über unseren Projektverbund hinaus ist uns wichtig und das hat unsere Arbeit bereichert. Dabei gingen die Initiativen, ganz im Sinne unseres WÖRLD House Konzeptes, sowohl von den Teilprojekten als auch von der Verbundleitung aus. Innerhalb unseres Kompetenzzentrums Sprachen/Gesellschaft/Wirtschaft liegen Verbindungen zum Projekt „Digitale Souveränität als Ziel wegweisender Lehrer:innenbildung für Sprachen, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften in der digitalen Welt (Diso-SGW)“ und dem Projekt „Videobasierte Fortbildungsmodule zum digital gestützten Unterrichten im Netzwerk bundesdeutscher Videoportale (ViFoNet)“ vor. Vertreter:innen dieser Verbünde haben an unseren WÖRLD-Verbundtreffen teilgenommen. Über die Grenzen unseres Kompetenzzentrums haben wir mit dem MINT-Projektverbund „Länder- und phasenübergreifendes Interface der beruflich-technischen Bildung (LPI)“ kooperiert, der ebenfalls in der beruflichen Bildung verortet ist und mit analogen Konzepten operiert. Ich möchte hier aber auch die Transferstelle mit ihren Vernetzungsaktivitäten erwähnen, die über ihre Aktivitäten wie beispielsweise die „Roadshows“ und „Querschnittsthemen“ vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten außer- und innerhalb der Grenzen von lernen:digital geschaffen hat.
Wie gelingt in Zukunft der Transfer der Fortbildungen und Materialien in die Lehrkräftebildung und in den Unterricht an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen? Konnten Sie im Rahmen des Projekts schon Kontakte mit den zuständigen Landesinstituten aufnehmen?
WÖRLD ist mit seinen 14 Teilprojekten in sieben Bundesländern vertreten. Die Bundesländer stellen unterschiedliche Vorgaben und Anforderungen an die Lehrpersonenfortbildung. Zudem ist die institutionelle Unterstützung in unterschiedlichem Maße ausgeprägt. Die Kontaktaufnahme zu den Landesinstituten erfolgte über die länderbezogenen Teilprojekte, wobei Unterstützung durch das WÖRLD-House erfolgte. Aus meiner Perspektive ist eine systematische Intensivierung der Kooperation mit den Landesinstituten für die Entwicklung und Beforschung der Lehrerkräftefortbildungen erforderlich. Zur Veranschaulichung sei an dieser Stelle ein Evaluationsergebnis aus dem WÖRLD-House angeführt. Im Rahmen der Befragung unserer Teilprojekte im Winter 2024 wurde festgestellt, dass die größten Herausforderungen in den Teilprojekten in den erheblichen „bürokratischen Hürden“ (z. B. Verfahren in den Landesinstituten) liegen.
Für die Zukunft des Transfers von Fortbildungsinhalten und -materialien sind jedoch weitere, auch strukturelle Veränderungen erforderlich. Gemäß dem Angebots-Nutzungs-Modell sind attraktive Fortbildungsangebote erforderlich, die nicht nur aktuelle, sondern auch prospektive Aufgabenerfordernisse adressieren. Darüber hinaus ist aus meiner Perspektive, die sich nicht auf empirische Evidenz stützt, für die wirtschaftsberufliche Bildung ein „neues“ Mindset bei den (zukünftigen) Lehrkräften erforderlich, das den Nutzen und die Notwendigkeit der Lehrpersonenfortbildung in einer sich dynamisch verändernden Berufswelt in den Mittelpunkt stellt. Es sind jedoch auch strukturelle Veränderungen zur Schaffung der Möglichkeit der Angebotsnutzung zu implementieren. In diesem Kontext ist die Diskussion um das Recht oder die Pflicht auf Fortbildung von zentraler Relevanz, eingebunden in eine systematische Schulentwicklungsprogrammatik.

„Aus meiner Perspektive ist eine systematische Intensivierung der Kooperation mit den Landesinstituten für die Entwicklung und Beforschung der Lehrerkräftefortbildungen erforderlich.“
Können Lehrkräfte auch direkt die als Open Educational Resources (OER) zur Verfügung stehenden Unterrichtsmaterialien und Handreichungen zu Lernumgebungen und Lehr-Lernprozesse erwerben?
Es ist unser Anliegen im Kompetenzverbund lernen:digital und in WÖRLD, alle Materialien kostenlos zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen. Sie müssen also nicht erworben werden, sondern stehen zum freien Download zur Verfügung. Wir möchten ja gerade zur Weiterentwicklung unserer Produkte anregen und diese fördern. Im Kompetenzverbund lernen:digital stehen hierfür die bekannten Plattformen zur Verfügung. Unsere WÖRLD-Teilprojekte nutzen zudem die Plattfomen HubbS und WirLernenOnline. Selbst die Aufzeichnungen unserer Ringvorlesung „Around the WÖRLD“ stellen wir über zenodo bereit.
Der Projektverbund WÖRLD
Im Projektverbund WÖRLD entwickeln 14 Teilprojekte praxiserprobte digitale Lernumgebungen, Unterrichtsszenarien und digital gestützte Lehr-Lernprozesse für die ökonomische und wirtschaftsberufliche Lehrpersonenbildung. Wir sprachen mit der Wissenschaftlichen Leitung, Prof. Dr. Jens Klusmeyer, über die Ergebnisse und darüber, wie der Transfer in die Lehrkräftebildung und den Unterricht gelingt.
Prof. Dr. Jens Klusmeyer

Jens Klusmeyer ist Professor für Wirtschaftspädagogik mit Schwerpunkt Berufliches Lehren und Lernen an der Universität Kassel. Seine zentralen Forschungsschwerpunkte umfassen wirtschaftsdidaktische Fragestellungen zur digitalen Kompetenzentwicklung von Lehrpersonen, zur beruflichen Unterrichtsforschung, zum Lernen am Arbeitsplatz, zur Unterrichtsplanungsforschung sowie zur Studieneingangsphase. Seit 2023 ist er Wissenschaftlicher Leiter des lernen:digital Projektverbunds „Wirtschaftspädagogik und Ökonomische Bildung: Lehrkräftebildung und Unterricht digital“ (WÖRLD).











