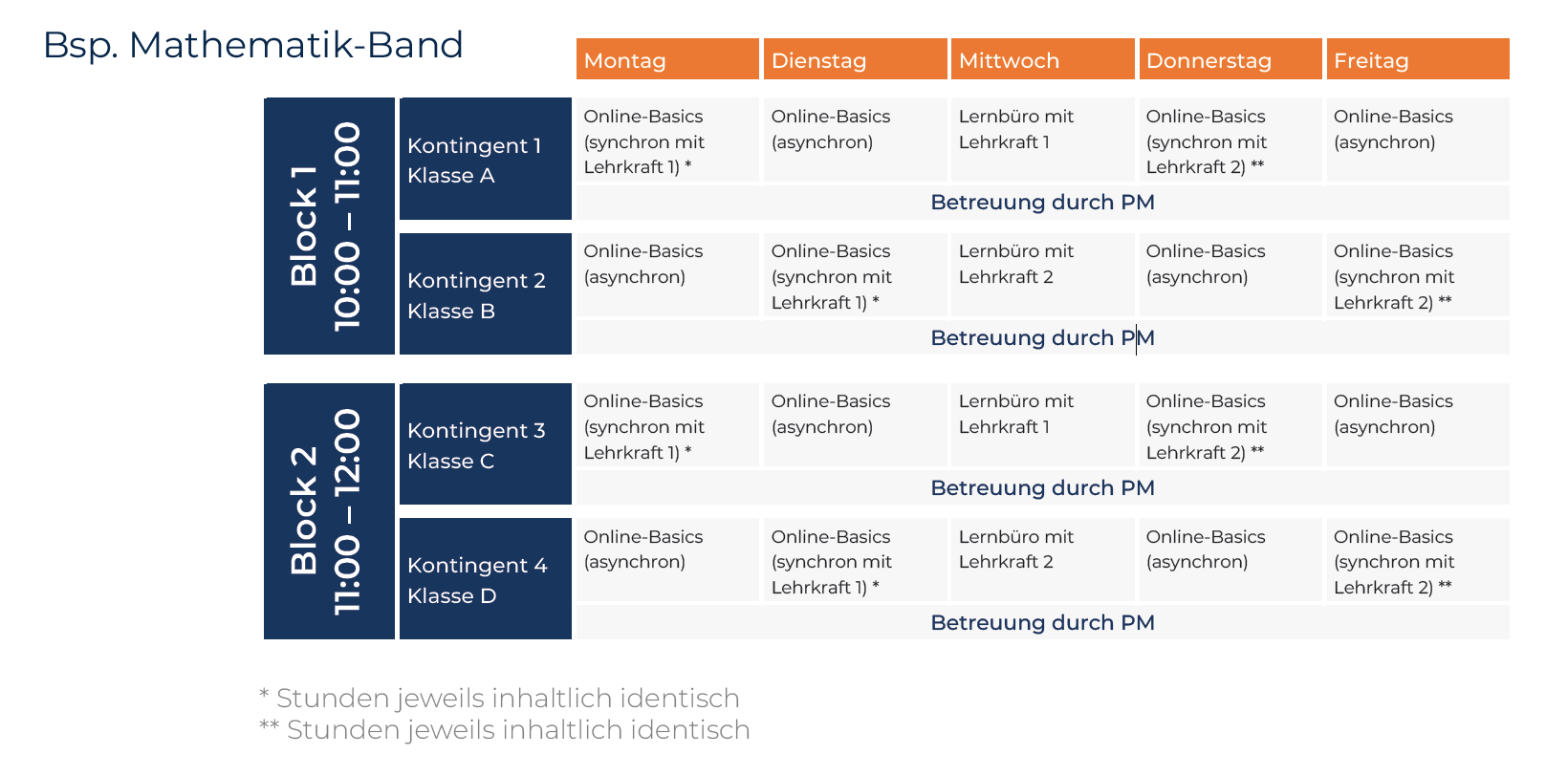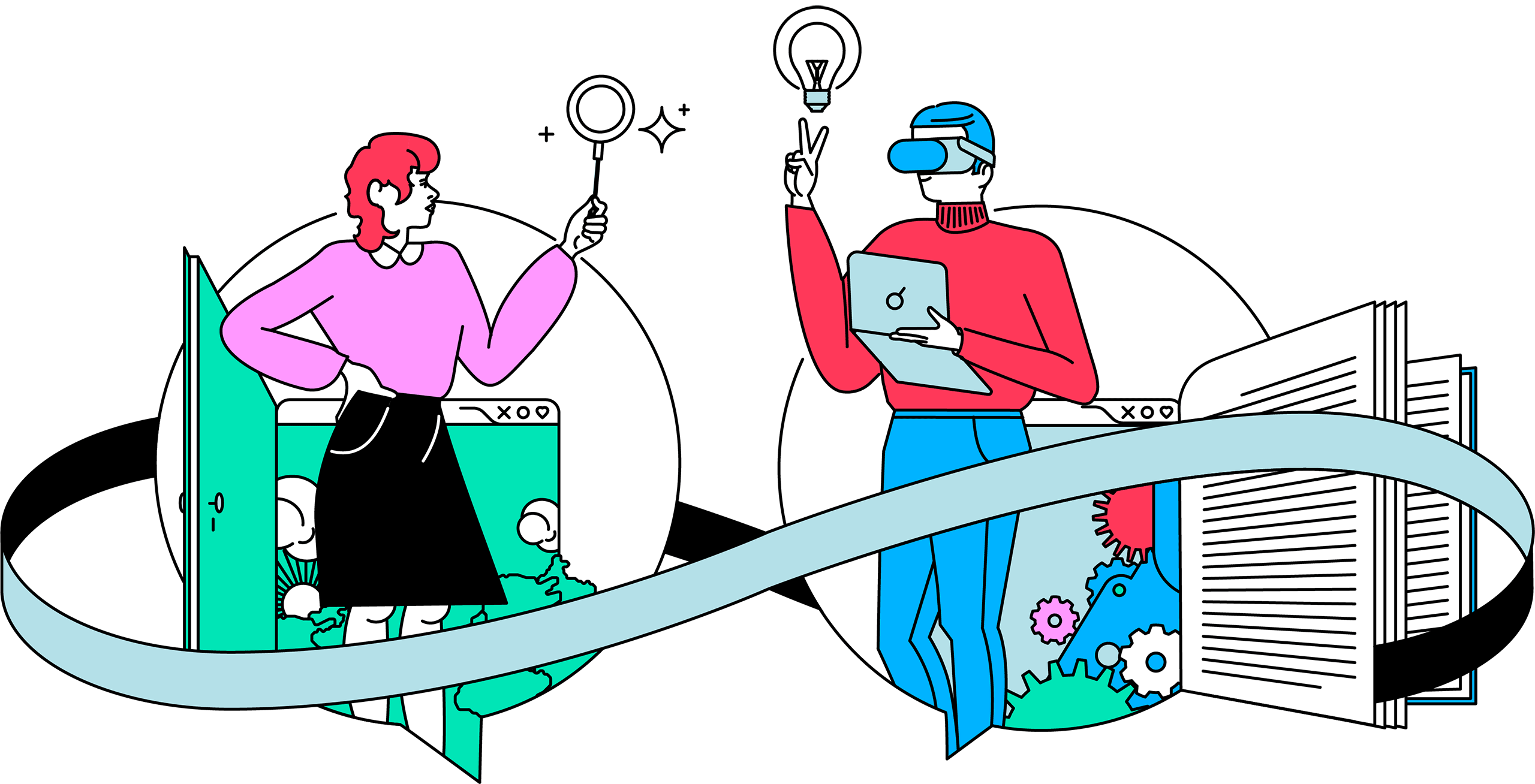
Der Kompetenzverbund lernen:digital gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung.
Über den Kompetenzverbund
Vier Kompetenzzentren bündeln die Expertise aus rund 200 länderübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten. In den Projekten entstehen evidenzbasierte Fort- und Weiterbildungen, Materialien sowie Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer Kultur der Digitalität.
Über die Kompetenzzentren
Eine Transferstelle macht die Ergebnisse für Lehrkräfte sichtbar, fördert die konstruktive Weiterentwicklung mit der Praxis und unterstützt den bundesweiten Transfer in die Lehrkräftebildung.
Über die Transferstelle
Individualisierung meint nicht den kurzfristigen Einsatz einer Methode, sondern eine langfristige und grundlegende Veränderung des Unterrichts. Die neue Struktur, die daraus entsteht, kann in allen Lernbereichen und in jeder Unterrichtsstunde umgesetzt werden. Das Ziel ist es, individuelle Lernbedarfe anzunehmen und passgenaue Aufgaben bereitzustellen.
Damit der Unterricht dies gut „verträgt“, wie es in der Frage heißt, sind einige Rahmenbedingungen wichtig:
- Dem traditionellen gleichschrittigen Unterricht weicht eine übergeordnete Organisationsstruktur, die konsequent eingehalten und immer wieder evaluiert werden muss.
- Für individualisierten Unterricht ist es besonders bedeutsam, dass die Lehrkraft einen guten Überblick erlangt, wo jedes Kind in seinem Lernprozess steht, nur so können passgenaue Aufgaben ausgewählt werden.
- Individualisierter Unterricht beinhaltet neben individuellen Lernphasen auch zahlreiche Gelegenheiten für gemeinsames Lernen, in denen trotzdem passgenau unterrichtet werden kann.
- Zur Umsetzung ist es ratsam, dass sich gleichgesinnte Lehrkräfte zusammentun und austauschen.
Wie diese Rahmenbedingungen umgesetzt werden können, wird im folgenden Text geschildert.
Was ist individualisierter Unterricht und wie wird er umgesetzt?
Grundlage ist die Annahme, dass jede:r aufgrund persönlicher (Lern-) Voraussetzungen individuell lernt und damit verbundene Bedarfe hat (Trautmann & Wischer, 2011). Um darauf zu reagieren, wird zunehmend gefordert, sich von der traditionellen grammar of schooling (Tyack & Tobin, 1994) zu lösen (Begrich et al., 2023; Dumont et al., 2024) und stärker auf individuelle Lernbedarfe einzugehen.
Bohl et al. (2012) unterscheiden zwei Formen von Individualisierung:
- Bei der Reinform wird jedem Kind ein individuelles Lernangebot unterbreitet, das aus individuellen Lernwegen, -zielen und -materialien besteht. Diese Form ist im Unterricht nur schwer umsetzbar und verlangt sehr viel Vorbereitung durch die Lehrkraft.
- Die zweite Form, um die es im Folgenden geht, bezieht sich auf die Dezentrierung von Unterricht. Dabei wird den Lernenden ein Angebot unterbreitet, das „ausreichend Anschlussmöglichkeiten für möglichst alle […]“ bereithält (S. 45). Hier wird den Lernenden selbst mehr Mitbestimmung und Verantwortung übertragen.
Damit individualisierter Unterricht gelingt, bedarf es Makro- und Mikroanpassungen. Makroanpassungen betreffen die langfristige Planung und Bereitstellung eines differenzierten Lernangebots; Mikroanpassungen erfolgen on the fly (Bach et al., 2025), wenn Lehrkräfte situativ reagieren oder individuell unterstützen (Corno, 2008).
Wie biete ich passgenaue Aufgaben an?
Die Basis für passgenaue Lernangebote bietet formelle und informelle lernbegleitende Diagnostik, wie etwa Aufgabenbesprechungen, Fragen oder standardisierte Lernstandserhebungen zu individuellen Zeitpunkten (Dumont et al., 2025; Schöler & Schabinger, 2017). Vortests zeigen bereits vorhandenes Wissen, Lernzielkontrollen den Lernerfolg (Wenzel et al., 2025).
Lernende mit geringem Vorwissen und geringer Selbstregulation benötigen viel Unterstützung und Steuerung durch die Lehrkraft (Dumont, 2018; Tetzlaff et al., 2025), etwa durch Scaffolding (van de Pol, 2010) oder direkte Instruktion (Kinder et al., 2005). Wichtig ist, dass Lehrkräfte Selbstregulationsstrategien vermitteln, damit Lernende zunehmend eigenständig arbeiten können (Corno, 2008). Kognitive (z.B. Concept Map) und metakognitive (z.B. Lernzielformulierung) Strategien sind hier förderlich (Dumont et al., 2025).
Für Lernende mit hohem Vorwissen und guter Selbstregulation kann zu viel Unterstützung und Steuerung lernhinderlich sein (Dumont, 2018), wie der Expertise Reversal (oder Umkehreffekt) zeigt (Tetzlaff et al., 2025). Sie profitieren von offenen Aufgabenformaten wie explorativem Lernen oder Peer-Tutoring, bei dem sie eine lehrkraftähnliche Rolle übernehmen (Corno, 2008). Ihre Eigenständigkeit schafft freie Zeitressourcen für Lehrkräfte, um andere zu unterstützen (Wenzel et al., 2025) oder den Unterricht weiter zu planen.
Was kann ich tun, wenn ich meinen Unterricht umgestalten möchte?
Damit individualisierter Unterricht gelingen kann, muss eine sinnvolle raum-zeitliche Organisationsstruktur aufgebaut werden (Breidenstein et al., 2017), die es ermöglicht, dass Lernende zunehmend selbst die Verantwortung für die Planung und Durchführung des eigenen Lernprozesses übernehmen (Wenzel et al., 2025). Diese Struktur kann durch Arbeitspläne, räumliche Organisation und Materialien vorgegeben werden. Das Einüben von Ritualen und Abläufen sichert das Einhalten der Struktur, die immer wieder auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden muss. Nur so behalten Lehrkräfte den Überblick über die Lernstände in der Klasse und können entscheiden, wer eigenständig lernen kann und wer Unterstützung benötigt (Wenzel et al., 2025). Kooperative Aufgaben, Unterrichtsgespräche und der Klassenrat runden den Unterricht ab und verhindern eine Vereinzelung von Lernwegen (Wenzel et al., 2025).
Viele Verlage bieten mittlerweile Aufgabensammlungen an, die im individualisierten Unterricht eingesetzt werden können. Entscheidend ist die passgenaue Auswahl auf individuelle Bedarfe (Wenzel et al., 2025), wobei adaptive Lerntechnologien helfen können (Dumont et al., 2025). Der Austausch von Inhalten, Methoden und Materialien mit gleichgesinnten Kolleg:innen kann ebenfalls hilfreich sein (Wenzel et al., 2025).
Vertiefung
In diesem Bereich finden Sie Linktipps, um sich noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen, und die Quellenangaben für den Beitrag.
Links
Quellenangaben
Was Sie auch interessieren könnte:
Britta Wenzel

Britta Wenzel ist studierte Sonderpädagogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bergischen Universität Wuppertal. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Individualisiertem und Adaptivem Unterricht, dem Umgang mit heterogenen Lernbedarfen und dem Unterstützungsverhalten von Lehrkräften. In diversen Lehrveranstaltungen vermittelt sie angehenden Lehrkräften neben methodischen, didaktischen und pädagogisch-psychologischen Grundlagen einen wertschätzenden Umgang mit Schüler:innen sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Lernbedarfe.