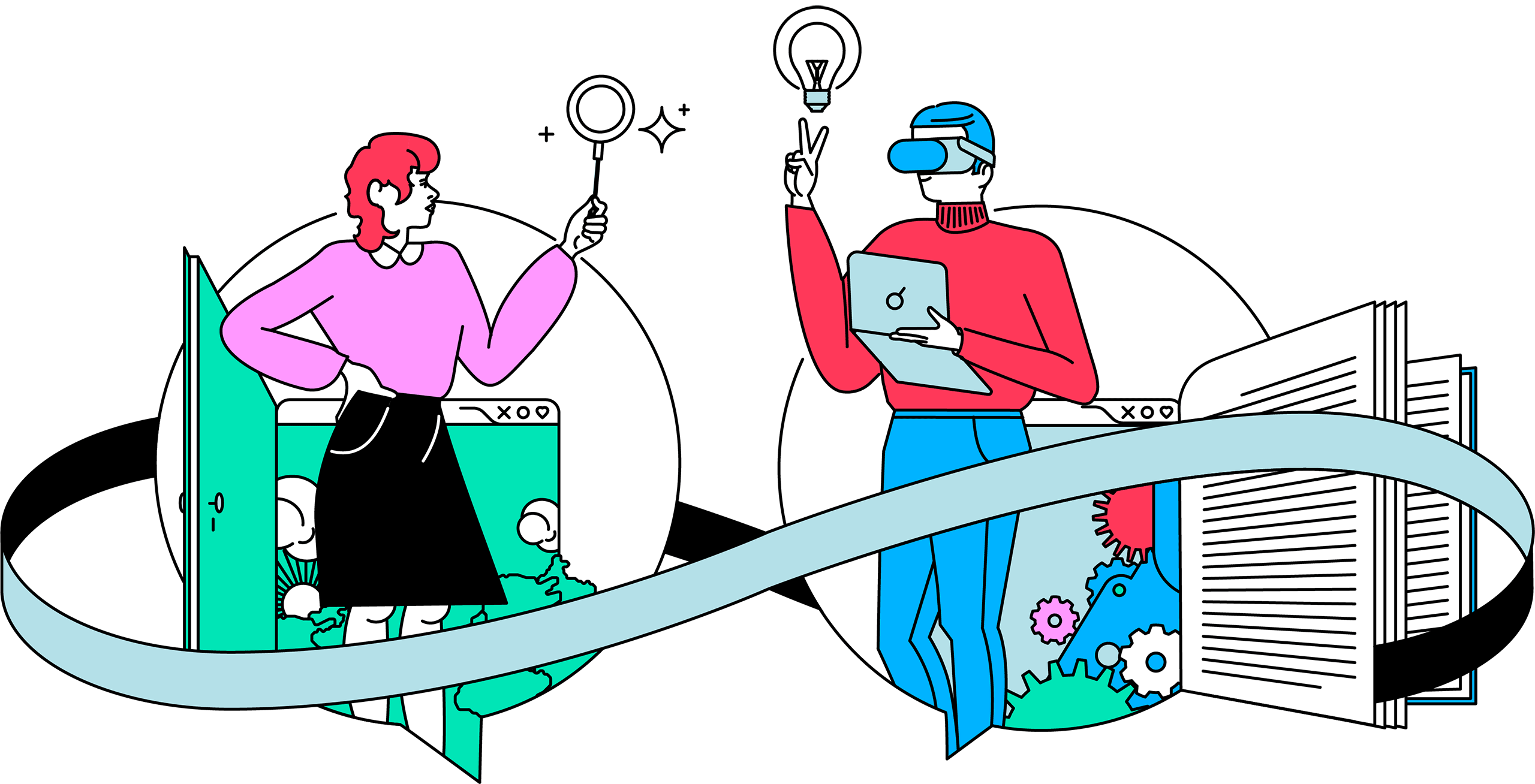
Der Kompetenzverbund lernen:digital gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung.
Über den Kompetenzverbund
Vier Kompetenzzentren bündeln die Expertise aus rund 200 länderübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten. In den Projekten entstehen evidenzbasierte Fort- und Weiterbildungen, Materialien sowie Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer Kultur der Digitalität.
Über die Kompetenzzentren
Eine Transferstelle macht die Ergebnisse für Lehrkräfte sichtbar, fördert die konstruktive Weiterentwicklung mit der Praxis und unterstützt den bundesweiten Transfer in die Lehrkräftebildung.
Über die Transferstelle
2,8 Milliarden: So viele Kurznachrichten werden in Deutschland pro Tag verschickt, das zeigt eine aktuelle Umfrage. Aber nicht nur die Zahl der privaten Nachrichten ist hoch, sondern auch die Menge der konsumierten (Welt-)Nachrichten und Informationen über TikTok, Instagram & Co. ist enorm. Insbesondere junge Menschen nutzen soziale Netzwerke als Informationsquelle. Dabei ist gerade dort Desinformation stark präsent. Um der Flut an Informationen im digitalen Raum selbstbestimmt und reflektiert zu begegnen, brauchen Schüler:innen einen kompetenten Umgang mit Nachrichten und Informationen. Auch im neuen Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD wird die Stärkung sowie Förderung von Nachrichtenkompetenz betont. Aber auf welche Art und Weise beeinflussen digitale Medien die Wahrnehmung und Meinungsbildung von Kindern und Jugendlichen? Wie können Schulen die Nachrichten- und Informationskompetenz von Schüler:innen fördern? Und wie können sowohl Lehrkräfte als auch Schüler:innen mit den schnelllebigen Veränderungen auf TikTok & Co. im Kontext des Nachrichtenkonsums umgehen? Über diese und weitere Fragen diskutieren wir im Community Call am 25. Juni 2025 von 16:00 bis 17:00 Uhr.
Wie können Kinder und Jugendliche lernen, seriöse Nachrichten von Desinformation zu unterscheiden? Julia Schmengler berät als medienpädagogische Beraterin des Landkreises Cuxhaven Schulen bei der Erstellung von Medienbildungskonzepten und berichtet im Community Call von ihren Erfahrungen.
Martin Spiewak ist Bildungsredakteur bei der ZEIT und als erweiterter Vorstand im gemeinnützigen Verein Journalismus macht Schule tätig. Er erklärt, wie Journalist:innen die Förderung von Nachrichten- und Informationskompetenz in der Schule stärken können.
Wie müssen sich journalistische Praktiken an einen veränderten Nachrichtenkonsum von jungen Menschen anpassen? Darüber spricht Tong-Jin Smith, Professorin für Journalismus an der Media University of Applied Sciences und freie Journalistin, im Community Call.
Dieser Community Call wird gemeinsam mit Journalismus macht Schule veranstaltet. Darüber hinaus ist diese Veranstaltung Teil des Aktionszeitraumes des Digitaltag 2025: Der bundesweite Aktionstag für digitale Teilhabe steht in diesem Jahr unter dem Motto „Digitale Demokratie: Mitreden. Mitgestalten. Mitwirken”.
