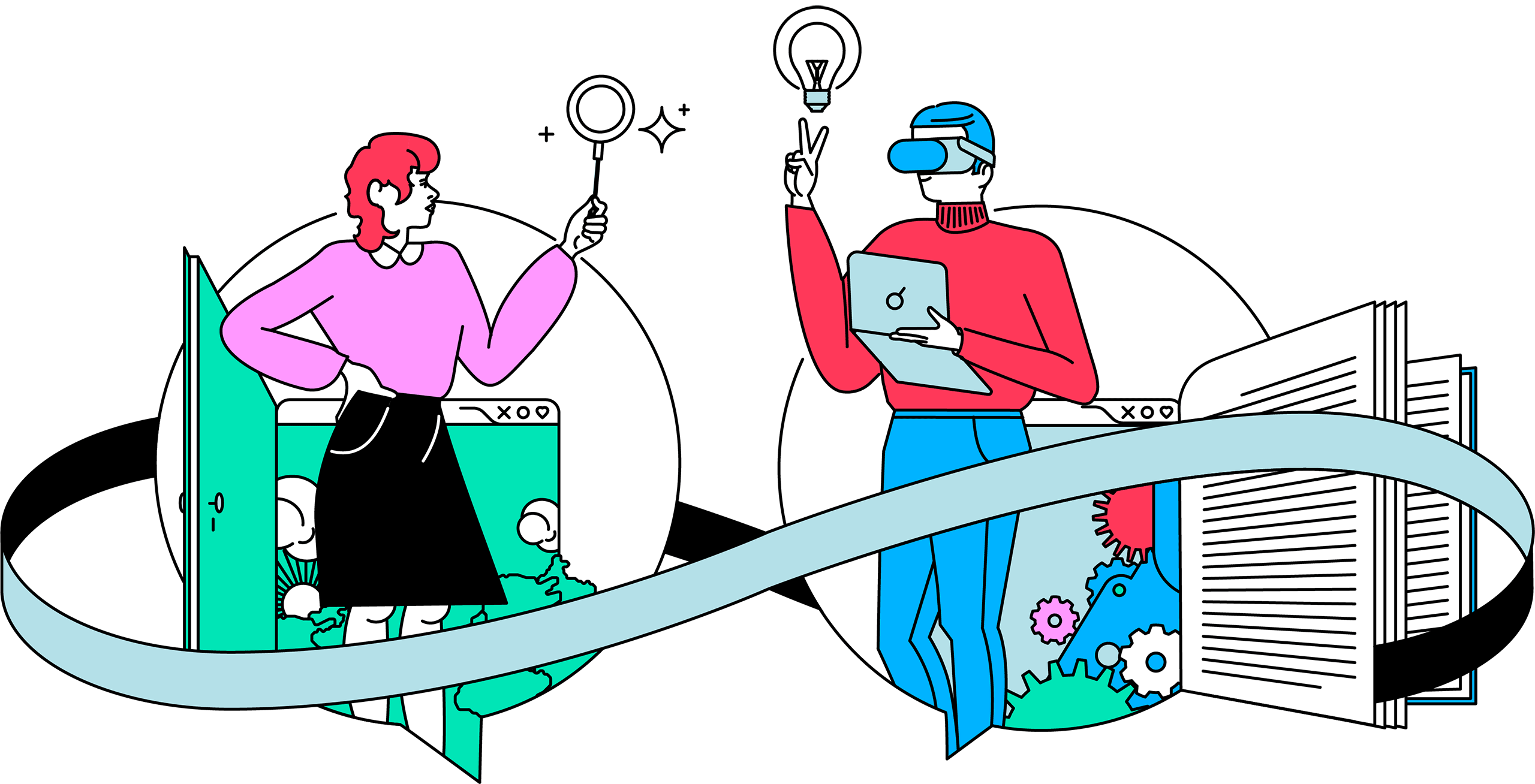
Der Kompetenzverbund lernen:digital gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung.
Über den Kompetenzverbund
Vier Kompetenzzentren bündeln die Expertise aus rund 200 länderübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten. In den Projekten entstehen evidenzbasierte Fort- und Weiterbildungen, Materialien sowie Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer Kultur der Digitalität.
Über die Kompetenzzentren
Eine Transferstelle macht die Ergebnisse für Lehrkräfte sichtbar, fördert die konstruktive Weiterentwicklung mit der Praxis und unterstützt den bundesweiten Transfer in die Lehrkräftebildung.
Über die Transferstelle
An der Universität Tübingen wird für Physik- und Chemielehrkräfte eine gemeinsame experimentelle Präsenzfortbildung zur digitalen Messwerterfassung für alle Schultypen angeboten.
Nach einer gemeinsamen Einführung haben die Teilnehmenden die Möglichkeit fachspezifische, einfache Versuche zur digitalen Messwerterfassung, die für den Einsatz in der Schule geeignet sind, direkt selbst auszuprobieren. Dabei wird es verschiedene Stationen mit Physik- und Chemieversuchen geben, die konkret im Bildungsplan verortet werden und mit unterschiedlichen digitalen Messwerterfassungssystemen, wie Mikrocontrollern aber auch “fertigen” Systemen von z.B. PASCO, durchgeführt werden können.
Mikrocontroller bieten für den naturwissenschaftlichen Unterricht einen Mehrwert, da mit diesen günstige Messwerterfassungssysteme auch von Schülerinnen und Schülern selbst erstellt werden können und neben experimentellen Fähigkeiten auch übergeordnete Ziele gefördert werden (z.B. BP BW Gym Physik – 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4, 2.2.5). Die intensive Beschäftigung mit der digitalen Messwerterfassung erlaubt es insbesondere den Blackbox -Charakter der Messgeräte aufzulösen, indem Lernende ein besseres Verständnis für den Messprozess selbst und die zugrundeliegenden physikalischen, chemischen und technischen Grundlagen entwickeln. Die ausgewählten Experimente sind im Programm mit den konkreten Bezügen zum Bildungsplan (Lernziele) vermerkt.
Im Rahmen der Fortbildung wird zudem auf adaptiven Unterricht eingegangen. Letzteres stellt eine Methode dar, die zunehmende Heterogenität in Schulklassen zu adressieren. Es werden die Grundlagen sowie die drei Phasen Formative Diagnose, Makroadaption und Mikroadaption thematisiert. Experimentiermaterialien, sowie Handreichungen für den direkten Einsatz der vorgestellten Versuche in der Schule werden für Sie zur Mitnahme in Form von kostenlosen Materialboxen und bearbeitbaren Dokumenten bereitgestellt. Zudem bieten wir einen Selbstlernkurs an, indem man sich zu unterschiedlichen digitalen Medien fortbilden kann. Die Einführung, sowie das Mikrocontrollermodul sind auch für Chemielehrkräfte geeignet.
Kontakt:
Simona Schöllhuber
Sekretariat Chemie Didaktik
Universität Tübingen
simona.schoellhuber@uni-tuebingen.de
07071 2978722
