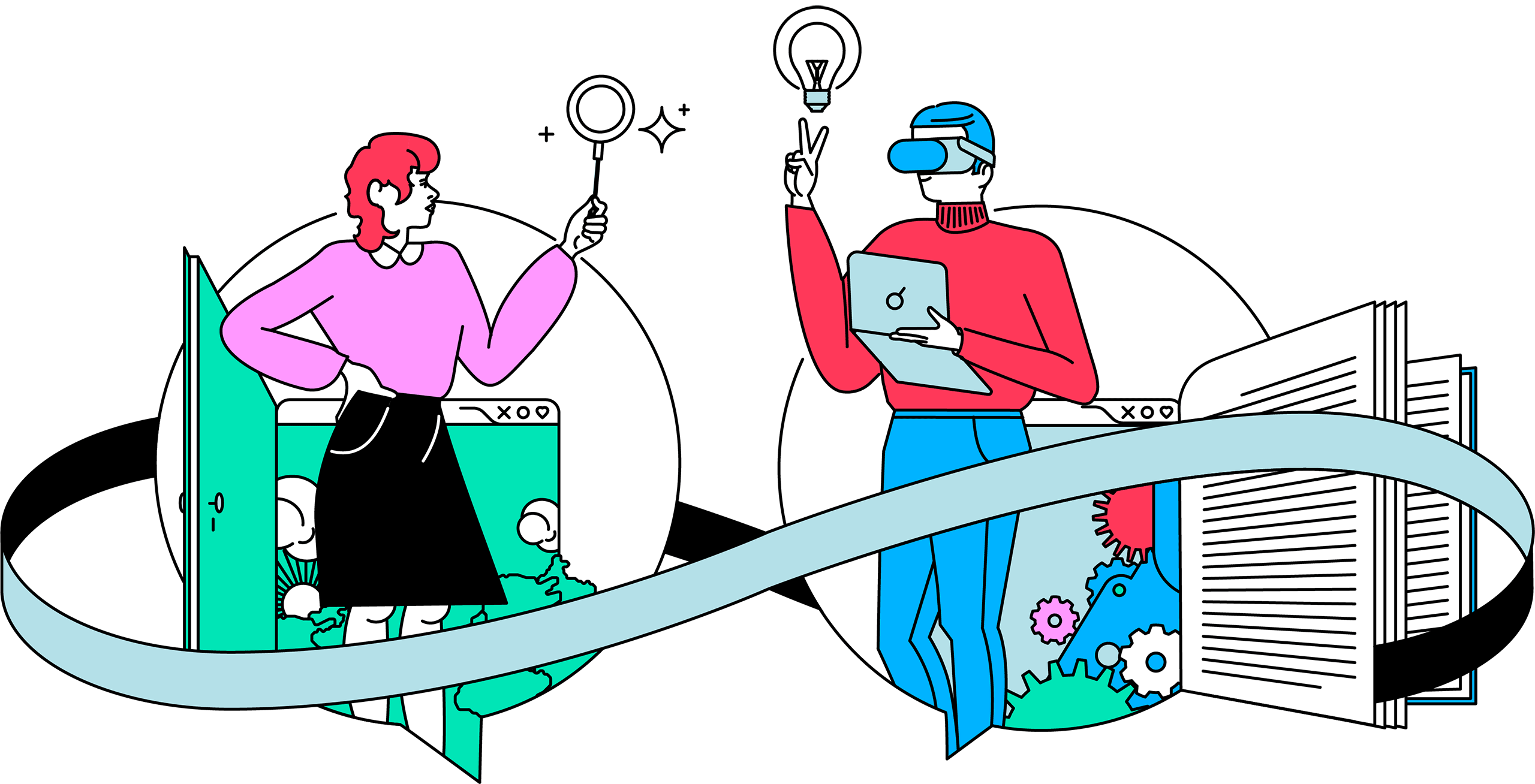
Der Kompetenzverbund lernen:digital gestaltet den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für die digitale Transformation von Schule und Lehrkräftebildung.
Über den Kompetenzverbund
Vier Kompetenzzentren bündeln die Expertise aus rund 200 länderübergreifenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten. In den Projekten entstehen evidenzbasierte Fort- und Weiterbildungen, Materialien sowie Konzepte für die Schul- und Unterrichtsentwicklung in einer Kultur der Digitalität.
Über die Kompetenzzentren
Eine Transferstelle macht die Ergebnisse für Lehrkräfte sichtbar, fördert die konstruktive Weiterentwicklung mit der Praxis und unterstützt den bundesweiten Transfer in die Lehrkräftebildung.
Über die Transferstelle
Takeaways
Lernziele im Fokus: Zukunftstechnologien als Tools sollten im Unterricht so ausgewählt werden, dass sie der Erreichung gewünschter Kompetenzen oder Lernziele dienen. Das bedeutet auch, auf sie zu verzichten, wenn sie nicht zu den Zielen beitragen.
Schnell individualisiertes Material: In der Digitalität ergeben sich neue Möglichkeiten, eine Vielzahl von individuell angepassten Darstellungsformen, sog. multiple Repräsentationen, und methodischen Zugängen für Unterrichtsinhalte schnell zu erstellen. Schüler:innen erhalten auf diese Weise leichter individuell erstellte Lernpfade für ihren eigenen, personalisierten Kompetenz- und Wissenserwerb.
Lernpfade mit Künstlicher Intelligenz: Prädiktive Künstliche Intelligenz erlaubt datenbasierte Vorhersagen über das Lernverhalten der Schüler:innen und kann so multiple Repräsentationen passend zu ihren Lernvoraussetzungen, -motivationen, -zielen und -entwicklungen auswählen. Dadurch lassen sich individuelle Lernpfade dynamisch und kompetenzorientiert anpassen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unterricht erfordert allerdings unter anderem auch einen transparenten Umgang mit dem Thema Datenschutz und Kompetenzen für die adäquate Anwendung entsprechender Tools.
Zunächst einmal die Frage an Sie, was heißt denn eigentlich Heterogenität im Schulkontext? Wie zeigt sie sich im Unterricht?
Jochen Kuhn: Ohne jetzt tief in die Forschung eingehen zu wollen: Heterogenität ist so zu sehen, dass Lernende mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernpräferenzen bei uns im Unterricht ankommen. Das ist auch kein Phänomen, das es erst seit heute gibt, sondern eigentlich schon seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten. Nur die Unterschiede zwischen den Lernenden sind größer geworden. Und es ist auch nicht nur so, dass das enge fachspezifische Lernvoraussetzungen sind, sondern auch Sprach- und Lesefähigkeit sowie Umsetzungskompetenzen. Die Unterschiede in diesen Voraussetzungen sind aus verschiedenen Gründen gerade in letzter Zeit auch zusehends größer geworden – wie uns auch die PISA-Studie zuletzt gezeigt hat.
Was müsste man denn hier tun, um unterstützen zu können?
Jochen Kuhn: Zunächst muss festgestellt werden, welche Lernvoraussetzungen die Schüler:innen zu Beginn des Unterrichts mitbringen. Dann müsste man die Schüler:innen gemäß ihren Lernvoraussetzungen, Lernpräferenzen und auch ihrer Motivation und ihren Einstellungen in unterschiedlicher Weise unterstützen. Wenn ich jetzt vom naturwissenschaftlichen Unterricht ausgehe, dann wissen wir sehr gut, dass wir in den Naturwissenschaften eine Art kognitiven Werkzeugkasten haben, der aus verschiedenen Darstellungsformen, sogenannten multiplen Repräsentationen besteht. Neben einem naturwissenschaftlichen Text findet man häufig eine Grafik oder auch eine Formel vor, was im Prinzip kognitive Werkzeuge sind, mit denen man den Inhalt und die domänenbezogenen Konzepte versteht. Die Präferenzen und Verarbeitungsfähigkeiten für diese Werkzeuge sind aber individuell verschieden. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise eine Schülerin mehr mithilfe eines Textes den Inhalt erschließen kann und eine andere Schülerin aber mit den formalen Zusammenhängen, ist das eine wichtige Information und Erkenntnis, um Lernende individualisiert fördern zu können.
Wie können innovative Technologien, also das, wozu Sie forschen, helfen, besser mit individuellen Unterschieden umzugehen?
Jochen Kuhn: Wenn man sich vorstellt, dass wir im Prinzip jeder Schülerin oder jedem Schüler die jeweils geeignete Darstellungsform anbieten müssten, ist dies natürlich im realen Klassenraum mit Papier und Bleistift sehr schwer möglich. Der Vorteil von Multimedia und Digitalität ist, dass solche verschiedenen Arten von Darstellungen sehr schnell erzeugt und in verschiedenen Formaten bereitgestellt werden können, weshalb sich digitale Medien für einen individualisierten Unterricht sehr gut eignen. Man muss nur verstehen, wie am besten individualisiert gelernt wird, um tatsächlich die gleichen Kompetenzen zu erwerben. Denn am Ende sollen alle Lernenden vergleichbare Kompetenzen haben, auch wenn der Weg dorthin individuell verschieden sein kann. Lernende erschließen somit naturwissenschaftliche Inhalte mit verschiedenen Arten von Repräsentationen, wobei die eine Schülerin besser mit einem Text oder mit einem Bild oder deren Kombination umgeht, der andere Schüler aber vielleicht besser mit einer Formel lernt. Dadurch kann man im Lernverlauf diese Schüler:innen entsprechend ihren Lernpräferenzen genau mit den individuell präferierten Darstellungen zu einem gleichen Lerninhalt unterstützen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Schulbuch, das genau solche Präferenzen erkennen und die Inhalte individualisiert anbieten könnte. Das würde bedeuten, dass die gleiche Schulbuchseite bei einer Schülerin anders aussieht als bei einer anderen, weil die Lernpräferenzen anders sind. Nur am Ende der Unterrichtseinheit sollen trotzdem alle die Leistungsüberprüfung erfolgreich meistern können.

„Der Vorteil von Multimedia und Digitalität ist, dass solche verschiedenen Arten von Darstellungen sehr schnell erzeugt und in verschiedenen Formaten bereitgestellt werden können, weshalb sich digitale Medien für einen individualisierten Unterricht sehr gut eignen. Man muss nur verstehen, wie am besten individualisiert gelernt wird, um tatsächlich die gleichen Kompetenzen zu erwerben.“
Jetzt haben Sie in Ihrer Forschung viel mit neuen Technologien wie Virtual Reality oder auch KI zu tun. Wie kommen solche Tools hier zum Einsatz, um diese Lernpfade zu gestalten?
Jochen Kuhn: Das eine ist, dass man den Schüler:innen diese Darstellungsformen bereitstellen, also passende Lernumgebungen erstellen muss. Dazu braucht man Medien, die solche Adaptionen auch ermöglichen. Da kommen Tools wie Virtual oder Augmented Reality ins Spiel, die gerade im naturwissenschaftlichen Unterricht, wo es auch ums Experimentieren geht, durchaus große Mehrwerte gegenüber traditionellen Medien haben. Wir wissen aus der Forschung, dass beim Experimentieren der größte Lerneffekt erreicht wird, wenn man reales und virtuelles Experimentieren kombiniert. Das kann man natürlich sequentiell machen. Man kann es aber auch zeitgleich machen, indem zum Beispiel mit Augmented Reality zusätzliche virtuelle Informationen zum realen Experimentaufbau mit einem digitalen Medium, wie einem Tablet oder einer intelligenten Brille, eingeblendet werden, die beim realen Experiment fehlen. Die Schüler:innen können dann, genau wie im normalen Realexperiment, die realen Experimentkomponenten variieren und sehen dann sofort die Effekte, die das beispielsweise auf virtuell eingeblendete Größen hat. So kann z.B. die Variation des elektrischen Stromes durch eine reale Magnetspule mit einem realen Netzgerät ein virtuell eingeblendetes Magnetfeld verändern.
Wenn ich aber verstehen möchte, welche Art von virtueller Unterstützung oder Darstellung das Experiment anreichern soll, muss ich wieder die individuellen Lernpräferenzen der Lernenden kennen. Und man muss vorhersagen können, was die beste Lernunterstützung wäre, damit die Schülerin und der Schüler erfolgreich lernt. Da kann Künstliche Intelligenz ins Spiel kommen, mit der man aufgrund des Schülerverhaltens versucht vorherzusagen, mit welchen Mitteln Schüler:innen am besten unterstützt werden können, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Dieses Schülerverhalten kann unterschiedlich erfasst werden. Man kann es z.B. mit Fragebögen oder Tests diagnostizieren und mit diesen Daten einen Algorithmus trainieren, der dann ein Lernprofil aufzeigt, das für andere Lernenden als Vergleich herangezogen wird. Bei anderen Lernenden wird geprüft, welches Profil vermeintlich am besten geeignet ist, um gleiches Lernverhalten vorherzusagen. Das Lernverhalten kann aber auch direkt mithilfe physiologischer Daten erfasst werden, beispielsweise mit Blickbewegungen, die eine hohe kognitive Prädiktion haben, also eine hohe kognitive Aussagekraft.

„Wir wissen aus der Forschung, dass beim Experimentieren der größte Lerneffekt erreicht wird, wenn man reales und virtuelles Experimentieren kombiniert.“
Haben Sie denn ein ganz konkretes Beispiel, wie so etwas auf einen Unterrichtsgegenstand angewendet werden kann?
Jochen Kuhn: Bleiben wir wieder bei unserem digitalen Schulbuch und gehen wir mal davon aus, dass es Blickdaten erfassen kann. Eine solche Technologie nennt man Eye-Tracker, die zwar immer noch zu teuer für Schulen ist, aber in naher Zukunft auch mithilfe integrierter Webcams möglich sein wird. Das heißt, dass jedes Gerät oder jedes digitale Medium, das eine Webkamera eingebaut hat, auch Blickdaten erfassen könnte. Wir sollten uns also nicht um die Frage kümmern, ob die Technologie irgendwann bereitsteht, sondern um die Frage des pädagogisch sinnvollen Einsatzes der Technologie. Gehen wir mal davon aus, dass Blickdaten durch das digitale Schulbuch kostengünstig und technologisch einfach erfasst werden können. Die Schülerin oder der Schüler liest entlang des Schulbuchs und die Lernumgebung erkennt aufgrund der blickdatenbasierten Interaktion mit den Darstellungen auf der Schulbuchseite, dass das Blickverhalten einem Blickmuster ähnelt, bei dem eine bestimmte Unterstützungsmaßnahme zum Lernerfolg geführt hat. Dann bekommt dieser Schüler oder diese Schülerin ebenso eine Unterstützungsmaßnahme in gleicher Form bereitgestellt. Würde diese Unterstützungsmaßnahme nicht der Lernpräferenz der Lernenden mit zugehöriger Lernvoraussetzung entsprechen, würde eine andere Unterstützungsmaßnahme eingeblendet und erfasst werden, wie die Schüler:innen damit lernen.
Was sind denn die pädagogischen Ziele und sinnvolle Einsatzgebiete für solche Technologien? Also was wollen Sie damit bewirken?
Jochen Kuhn: Als fachbezogene Bildungsforscher gehen wir der Frage nach, wie man Schüler:innen, kognitiv und affektiv zum besten Lernergebnis führen kann. Dazu gibt es etablierte Lerntheorien aus denen wir den sinnvollen Einsatz von KI, AR und VR ableiten können. Wir fragen uns immer, welches (Lern-)Ziel erreicht werden soll, und basierend auf welchen dazu passenden Lerntheorien, welche Hypothesen ableitbar sind (für z.B. Lernzuwachs, Lernerfolg oder auch Motivationsförderung). Erst dann entscheiden wir, ob und, wenn ja, welches Tool geeignet ist, um diese Hypothese am besten zu bestätigen oder zu verwerfen. Das bestmöglich geeignete Tool muss gar nicht immer KI oder sonst eine Technologie sein. Also: nicht die Technologie um der Technologie willen einsetzen, sondern um damit den Zweck der dahinterstehenden, pädagogisch-psychologischen Frage-/Zielstellung zu erfüllen. So spielen auch stets ganz typische Fragen der Bildungsforschung, wie beispielsweise Fragen zum selbstregulierten Lernen oder Feedback eine große Rolle, die jetzt mittels großer Sprachmodelle wie ChatGPT auf eine ganz neue Art und Weise adressiert werden können. So stellt sich etwa die Frage, in welcher Weise Feedback, das von einem KI-Chatbot gegeben wird, auch wirklich erfolgreich für das Lernen ist oder dafür verwendet werden könnte. Solche und andere Fragestellungen sind noch unbeantwortet, und müssen in kommender Zeit umfassend untersucht werden.
Wenn Sie sagen, Sie müssen solche Fragestellungen untersuchen, gehen Sie ja wahrscheinlich auch in Schulklassen und untersuchen das auch wirklich vor Ort. Wie wird denn das Angebot im Unterricht angenommen? Also was sagen Schüler:innen, Eltern und auch Lehrer? Sehen sie den Bedarf bzw. die Idee dahinter oder gibt es da auch Bedenken, die Sie dann adressieren müssen?
Jochen Kuhn: Sowohl als auch. Das Problem bei KI ist beispielsweise, dass heutzutage der Begriff KI häufig mit ChatGPT oder mit Sprachmodellen gleichgesetzt wird, was eigentlich falsch bzw. zu eingegrenzt ist, weil Sprachmodelle oder ChatGPT nur eine Facette von KI sind. Von daher ist das ein Problem, auf das hingewiesen werden muss. Die Grundidee, die hinter Künstlicher Intelligenz steckt, ist eigentlich immer gleich: dass Daten vorhanden sind, mit denen Vorhersagen gemacht oder aus denen Informationen/Inhalte erzeugt werden können. Daher sind in diesem Kontext Datenschutzbedenken auch völlig legitim, weil Schule ein Schutzraum ist, in dem Schüler:innen lernen sollen, ohne sich Sorgen über die Unversehrtheit der Daten machen zu müssen. Das muss alles sicher erfasst, verarbeitet, gespeichert und weitergegeben werden.
Alles in allem sehen wir, dass dieses Thema in der Gesellschaft bereits so breit verankert ist, dass es ein bleibendes Phänomen sein wird. Das heißt, die Gesellschaft muss noch stärker auf dieses Thema und dessen Für und Wider sensibilisiert und über den sachgerechten, reflexiven Umgang damit aufgeklärt werden. Prinzipiell stellt sich für einen Einsatz insbesondere auch im Bildungsbereich immer die Frage des Mehrwerts. Der Mehrwert kann auch die Entlastung von Lehrkräften oder von Eltern sein, wozu solche Tools auch geeignet sind. Dabei muss auch auf Risiken der Technologien, wie z. B. von Halluzinationen bei Sprachmodellen, geachtet werden. Solche Fragen spricht man mit den Beteiligten transparent an und klärt offene Fragen. Man muss von Anfang an auch das ganze Thema Datenschutz sehr klar offenlegen. Welche Daten werden erhoben? Was macht man damit? Wie werden sie technisch transferiert? Wo werden sie gespeichert? Wer hat Zugriff darauf? All das müssen die Eltern, Schüler:innen, die Lehrkräfte, die Schulen und auch natürlich die Aufsichtsbehörden und Datenschutzbeauftragten wissen und dann auch genehmigen, dass man das tun darf.

„Wir fragen uns immer, welches (Lern-)Ziel erreicht werden soll, und basierend auf welchen dazu passenden Lerntheorien, welche Hypothesen ableitbar sind (für z.B. Lernzuwachs, Lernerfolg oder auch Motivationsförderung). Erst dann entscheiden wir, ob und, wenn ja, welches Tool geeignet ist, um diese Hypothese am besten zu bestätigen oder zu verwerfen.“
Gibt es weitere Rahmenbedingungen, die Sie herstellen müssen, also zum Beispiel auch, was die Lehrkräfte betrifft? Brauchen sie Schulungen, wie Zukunftstechnologien eingesetzt werden können?
Jochen Kuhn: Das hängt ein bisschen von der Technologie ab. Wenn wir bei dem hoch dynamischen Thema KI, und jetzt speziell ChatGPT oder Sprachmodellen im Ganzen, sind, dann ist es schon so, dass es sich dabei um sehr mächtige Tools handelt, bei denen es aber auch sehr viel Expertise bedarf, um sie adäquat zu nutzen. Das heißt also, auch hier ist ein wichtiger Auftrag an uns als Einrichtungen der Lehrkräftebildung, diejenigen, die sich damit beschäftigen, also Lehrkräfte, aber auch Entscheidungsträger wie Kultusministerien sowie Eltern und natürlich auch Lernende selbst, von Anfang an einzubeziehen und mitzunehmen. Das bedeutet, dass sie sich kompetent fühlen, solche Tools zu nutzen und sich befähigt fühlen zu entscheiden, ob ein Tool oder ein Verfahren, ein Medium für ein gewünschtes Unterrichtsziel geeignet ist. Also eine Art reflexive Medienkompetenz.
Das gilt für KI in besonderem Maße, weil neben der Mächtigkeit des Tools auch eine hohe Sensibilität gegenüber der Bedienung besteht. Wenn man bedenkt, dass vor 24 Monaten niemand etwas mit dem Wort Prompt/ing anfangen konnte und es jetzt aber eine große Rolle für die Bedienung eines fast täglich verwendeten KI-Tools spielt, ist die Dynamik des ganzen Themas erkennbar. Prompt bedeutet aber nichts anderes als die Kommunikation des Menschen mit einem KI-Sprachmodell. Die Art der Kommunikation, dieser Aufforderung, entscheidet in höchstem Maße über die Reaktion des Chatbots – und das ist in diesem Fall genau die Kompetenz, die mittlerweile für Lernende aber auch für Lehrende sehr relevant ist. Infolge der Komplexität dieser Zusammenhänge sind Promptingstrategien keine Selbstläufer. Genau darum ist es umso wichtiger, dass man Lehrkräfte dazu ausbildet, weil die Möglichkeiten, die solche Tools bieten, sehr groß sind – aber auch die Risiken, die bei falscher Verwendung bestehen.
Wir hatten es von Lehrkräften, jetzt geht es auch darum, die Schüler:innen anzusprechen, wie Sie gesagt haben, vielleicht zu motivieren. Wie reagieren die Schüler:innen typischerweise auf, zum Beispiel, sowas wie den Einsatz von ChatGPT aber auch AR/VR?
Jochen Kuhn: Auch da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Reaktionen. Wenn man die Technologien sehr fachbezogen einsetzt, dann werden sie prinzipiell, wie ein Tool sehr zielgerichtet verwendet. Dann wird die Lernumgebung auch von den Schüler:innen nicht so wahrgenommen, wie eine VR-Brille, die sie zu Hause für ein Videospiel verwenden. Es wird aber schon damit verglichen. Das heißt also, die Verwendung einer Technologie, die im Alltag schon Einzug gehalten hat, hat auf affektiver Ebene auch gleich das Konkurrenzlevel mit den Angeboten, die im Alltag verfügbar sind. Das ist natürlich auch wieder ein zweischneidiges Schwert, weil z. B. Lernangebote im Format von sehr designorientierten Spielen eben nicht die Regel sind. Aber unseren Erkenntnissen nach, werden die Schüler:innen nicht vom Lerninhalt abgelenkt, wenn das Tool fachbezogen eingesetzt wird. Auch wenn Lernumgebungen in der Regel nicht diesen Spaßeffekt wie eine Spieleumgebung haben, können sie beim Erschließen neuer Dinge – z. B. Unsichtbares sichtbar machen – bei den Schüler:innen einen „Wow-Effekt“ erzeugen. Wir hatten jetzt gerade zuletzt eine Lerngruppe in unser Schülerlabor eingeladen, die bei uns die physikalischen Zusammenhänge in einem Teilchenbeschleuniger exploriert haben. Sie arbeiteten mit einem LEGO Modell eines CERN Teilchendetektors. Sobald die Schüler:innen eine AR-Brille aufsetzten oder ein iPad vor das LEGO Modell hielten, sahen sie virtuell augmentiert über den realen Komponenten des Modells, wie die Teile des Beschleunigermodells funktionieren und konnten die physikalischen Zusammenhänge dazu explorieren. In solchen Situationen ist die erste Schülerreaktion oft ein Wow-Effekt! Aber für uns als Bildungsforscher heißt es natürlich noch nicht, dass sie damit besser lernen. Einen Wow-Effekt zu erzeugen ist nicht das (einzige) Ziel, sondern es geht vor allem darum, Lernen zu fördern.

„… hier ist ein wichtiger Auftrag an uns als Einrichtungen der Lehrkräftebildung, diejenigen, die sich damit beschäftigen, also Lehrkräfte, aber auch Entscheidungsträger wie Kultusministerien sowie Eltern und natürlich auch Lernende selbst, von Anfang an einzubeziehen und mitzunehmen. Das bedeutet, dass sie sich kompetent fühlen, solche Tools zu nutzen und sich befähigt fühlen zu entscheiden, ob ein Tool oder ein Verfahren, ein Medium für ein gewünschtes Unterrichtsziel geeignet ist.“
Wenn eine Lehrkraft so eine Zukunftstechnologie im Unterricht einsetzen möchte, wie kann sie vorgehen?
Jochen Kuhn: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es für das Design von Lernumgebungen mit AR oder VR spezifische Applikationen, mit denen sich die Lehrkräfte modulartig ihre Lernbausteine zum Beispiel zu einem Experiment zusammenstellen können. Dann können die sie, beispielsweise in eine AR-Umgebung zur Optik oder Elektrik, mit ihren iPads virtuelle Zusatzinformationen oder Visualisierungen über die realen Komponenten des Experiments einblenden. Bei KI ist ebenso – auch dazu gibt es Tools. Entweder nutzt man vorhandene Umgebungen, wie z. B. ChatGPT, wenn man eine datenschutzgerechte Nutzung berücksichtigt, und muss dann aber auch befähigt sein, angemessen mit dem System zu kommunizieren, also zu prompten. Es gibt auch Tools, die Hilfestellungen bei der Verwendung solcher KI-Tools bieten, indem sie Prompt-Beispiele bereitstellen, die Lehrkräfte verwenden oder anpassen und ihre eigenen Unterrichtsmaterialien selbst erstellen können. Sie können zu ihren Materialien auch „Musterlösungen“ eingeben, sodass das Feedback oder die Antwort des Chatbots nicht fehlerhaft ist, also die Wahrscheinlichkeit für Halluzinationen minimiert wird. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass Lehrkräfte zumindest grundlegend befähigt werden solche Tools im Unterricht einzusetzen– das betrifft sowohl ein Lernen mit als auch ein Lernen über KI.
Prof. Dr. Jochen Kuhn

Jochen Kuhn ist Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik der Physik an der Fakultät für Physik der LMU München. Seine Forschungsschwerpunkte sind das Lernen und Problemlösen mit multiplen Repräsentationen unter Verwendung von Zukunftstechnologien (AR/VR), das Lehren und Lernen mit und über künstliche Intelligenz in MINT-Fächern und die Verwendung physiologischer Messverfahren zur Analyse von Lernprozessdaten (z.B. Eyetracking oder EEG).
Jochen Kuhn hat das Immersive Quantified Learning Lab (iQL) am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) aufgebaut und ist seit Mai 2024 Fellow der Konrad Zuse School of Excellence in Reliable AI (relAI). Dort koordiniert er den Forschungsbereich „AI in Education“.
Vertiefung
In diesem Bereich finden Sie vertiefende Informationen, Literatur und Links, um sich noch näher mit dem Thema zu beschäftigen.
Links
Weiterführende Literatur
- Zum Artikel: Auswirkungen von Augmented Reality auf das Lernen und die kognitive Belastung in Physik-Laborkursen an Universitäten (englischsprachiger Fachartikel – freier Zugang)
- Zum Artikel: Der Einsatz von Augmented Reality zur Förderung des konzeptionellen Wissenserwerbs in MINT-Laborkursen – Theoretischer Hintergrund und empirische Ergebnisse (englischsprachiger Fachartikel – freier Zugang)
- Zum Artikel: Generative Künstliche Intelligenz in Unterricht und Unterrichtsforschung – Chancen und Herausforderungen (deutschsprachiger Fachartikel – freier Zugang)
- Zum Artikel: Künstliche Intelligenz im Lehr-Lernprozess von MINT-Fächern: Vom adaptiven Lernmaterial zur Implementation in die Lehrkräftebildung (deutschsprachiger Fachartikel)


